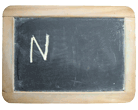Forschungprojekt von artifex zur Architektenausbildung
›ZWISCHEN KUNST UND WISSENSCHAFT - SCHAUSAMMLUNGEN ALS LABORATORIEN‹
Studien zur Rolle der Lehrmittelsammlungen an Architekturfakultäten Technischer Hochschulen
Architektur_Lehr_Sammlung
Das Forschungsprojekt widmet sich der Aufgabe, die Bedeutung und inhaltliche Struktur von historischen Lehr- und Schausammlungen als Ausbildungsmodul für angehende Architekten, vornehmlich an Technischen Hochschulen analysierend in den Blick zu nehmen. Dabei basiert die thematische Eingrenzung auf der These, dass es gerade die in der Phase der Etablierung und Expansion befindlichen Technischen Hochschulen, insbesondere deren Architekturfakultäten waren, die innovative Vermittlungsstrukturen entwickelten, um den besonderen Bedürfnissen der Studierenden technischer Fächer und ihrem eigenen, künstlerischen Selbstverständnis gerecht zu werden.
Assoziations- und Denkräume
Im akademischen Gefüge des 19. Jahrhunderts mussten Technische Hochschulen noch Jahrzehnte nach ihrer Gründung um wissenschaftliche Reputation ringen, weil sie aus universitärer Sicht die ‚anrüchigen‘ technischen Disziplinen beherbergten und sich damit dem vermeintlich dominanten Humboldtschen Ideal der zweckfreien Wissenschaft versagten. Dieser Kritik versuchte man mit zahlreichen Reformen zu begegnen, wodurch die Lehre ständig zwischen den durch die Universitäten gesetzten Normen der Wissenschaftlichkeit und den in der Industrie entwickelten Ansprüchen an die Praxis oszillierte. In dieser Gemengelage Position zu beziehen, stellte bis zur Jahrhundertwende das Grundproblem der Technischen Hochschulen dar. In diesem von hitzigen Diskussionen getragenen Theorie-Praxis-Streit galt es, die apodiktischen Konzepte von Bildung und Ausbildung zu harmonisieren. Dafür wurden in den Lehrsammlungen Assoziations- und Denkräume modernen, synergetischen Zuschnitts geschaffen, in denen zudem die Prozesshaftigkeit von Wissenschaft theoretisch wie praktisch vermittelt wurde.
Dingwelten der gebauten Umwelt
In den Architekturabteilungen wurde ein Sammlungsbestand verhandelt, der – ihrem Selbstverständnis als Architekt, Wissenschaftler, Künstler, Techniker und Ingenieur gerecht werdend – unterschiedlicher nicht sein konnte. Während die Vorlagensammlung, Architekturmodelle, Gipsabgüsse nach antiken Skulpturen oder die Baustoffsammlung eher zum allgemeinen Repertoire gehörten, wurden die Bestände mancherorts um ein Vielfaches erweitert: So lassen sich bspw. Kopien mittelalterlicher Glasfenster, Spolien, Gemälde- und Vasensammlungen, archäologische Fundstücke, zeitgenössische Kunst bis hin zu Textilien und Schmetterlingen finden. Dabei wurde die Auswahl nicht unerheblich von persönlichen Interessenslagen getragen, wenngleich die eigentliche Struktur der Architektenausbildung einem übergreifenden Lehrplan folgte.
Wissen(schaft)skommunikation
Neben den Sammlungs-Autopsien, welche je nach Quellenlage Aufschluss über die Verfasstheit, Präsentation und Funktionszusammenhänge geben, gilt es u.a. folgenden Fragen nachzuspüren: Welche Arbeitsstrukturen und -praktiken lassen sich in einer Lehrmittelsammlung als Mittel der Wissensproduktion und -kommunikation finden? Inwieweit wurde hier ein neuer ‚Museumstypus‘ generiert? Welche Bedeutung spielten die Vertreter der Fachdisziplin Kunstgeschichte bei der Sammlungs- und Vermittlungskonzeption?
So wird für das Forschungsprojekt die Rolle der Sammlungen bei der Konstituierung von Wissen ebenso von Belang sein, wie die Sammlung als Instrument der Forschung, als Modul der Lehre sowie als
Form der nach innen und außen gewandten Repräsentation in Form von Handlung- und Austauschprozessen.