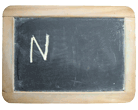Dr. Angelika Glesius M.A.
Biographisches
Geb. 1980. Ab 2000 Studium der Kunstgeschichte, Geographie und Ethnologie an der Universität Trier. 2006/07 Magisterarbeit in Kooperation mit dem Musée National d’Histoire et d’art Luxembourg über die Gartenanlage des Renaissance-Schlosses des Generalgouverneurs Peter Ernst von Mansfeld in Luxemburg-Clausen. Februar 2007 Magisterprüfung bei Prof. Dr. Bernd Nicolai. Publikation der Arbeit im Katalog zur Ausstellung „Un prince de la Renaissance. Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604)“ des MNHA. Seit Sommer 2007 Promotion bei Prof. Dr. Dr. Andreas Tacke zum Thema „Spätgotischer Kirchenbau im alten Erzbistum Trier unter Erzbischof Johann II. von Baden (1456-1504)“. Stipendiatin der Landesgraduiertenförderung und der Nikolaus-Koch-Stiftung.
Stipendien
- Promotionsstipendium der Stiftung zur Förderung begabter Studierender und des wissenschaftlichen Nachwuchses des Landes Rheinland-Pfalz
Promotion (bei Prof. Dr. Dr. Tacke)
Spätgotischer Kirchenbau im alten Erzbistum
Trier unter Erzbischof Johann II. von Baden (1456-1504)
Im Mittelpunkt der Arbeit steht der spätgotische Kirchenbau der 2. Hälfte des 15. Jhs. im alten Erzbistum Trier. Dabei soll besonderes Augenmerk auf die unter Erzbischof und Kurfürst Johann II. von Baden (1456-1502) neu entstandenen und/oder umgebauten bzw. „modernisierten“ Kirchen gelegt werden. Diese wurden in der bisherigen Forschung, bis auf Einzelmonographien, nicht in einer Zusammenschau betrachtet. Auch auf die Bau- und Stiftungspolitik Johanns II. von Baden, der scheinbar sämtliche in seiner Regierungszeit entstandenen Baumaßnahmen durch sein Wappen kennzeichnete, und deren Hintergründe, soll näher eingegangen werden. Neben den bekannteren Bauten in den Zentren des Erzstiftes Trier – Trier und Koblenz - entstanden in der 2. Hälfte des 15. Jhs. im gesamten Erzbistum bedeutende spätgotische Bauten, so etwa in St. Wendel, in Klausen oder die Kirche des ehem. Kreuzherrenklosters Helenenberg. Neben den allgemein bekannteren Bauten sollen in der geplanten Dissertation aber vor allem auch die zahlreichen ländlichen Pfarrkirchen in Eifel, Hunsrück, Westerwald und Rhein-Lahn-Kreis gewürdigt werden. Diese blieben in der bisherigen kunsthistorischen Forschung außen vor, obwohl sie zum Teil von großer künstlerischer Qualität zeugen und einen wesentlichen Beitrag der Kunst- und Kulturgeschichte des Trierer Raumes leisten. Mit einer solchen Arbeit könnte eine Lücke der bisherigen Forschung zum spätmittelalterlichen Kirchenbau in Westdeutschland geschlossen werden, was nicht nur aus kunsthistorischer Sicht, sondern auch aus lokal-historischer, sozial- und kirchengeschichtlicher Sicht dringend erforderlich wäre.
Magisterarbeit
Das Hypaethrum Neptuni und die Grotte
des Château
Mansfeld ‚La Fontaine’ in Luxemburg-Clausen
Die Arbeit befasste sich mit der bauforscherischen und kunsthistorischen Untersuchung des so genannten Hypaethrum Neptuni und der künstlichen Grotte des Schlosses „La Fontaine“, der Residenz des Generalstatthalters Graf Peter Ernst I. von Mansfeld in Luxemburg-Clausen. Die beiden etwa 1578/80 entstandenen Bauteile befanden sich im Sockelgeschoss des Schlosses, gehörten funktional aber eher zum Garten und waren nicht als Wohnräume gedacht. Das Hypaethrum, ein unüberdachter Raum mit einem zentralen rechteckigen Brunnenbecken, war von einer begehbaren Arkadenstellung umschlossen. Im Zentrum befand sich eine Figurengruppe aus Neptun und Amphitrite. Die angrenzende Grotte, ein fast komplett geschlossener rechteckiger Raum, diente der Präsentation einiger zeitgenössischer und antiker Kunstwerke, die in Wandnischen eingelassen waren. Neben der Beschreibung und Verortung der Bauteile selbst wurde auch die zugehörige Ausstattung, das Figurenprogramm näher untersucht. Die Bauteile Grotte und Hypaethrum, wie vergleichende Betrachtungen herausstellten, waren als Elemente der Gartenarchitektur damals hochmodern. Auf internationaler Ebene waren sie in ihrer Ausgestaltung sicherlich singulär, jedoch formal und was ihre Ausstattung anbelangt, gehörten sie zum internationalen höfischen Standard. Aufgrund ihres Stellenwertes innerhalb der europäischen höfischen Schloss- und Gartenarchitektur liegt die Vermutung nahe, dass international bekannte Künstler wie Hans Vredemann de Vries oder Salomon de Caus am Entwurf der Gartenanlage und deren architektonischen Elementen beteiligt waren.
Der Großteil der Arbeit wurde anlässlich der Ausstellung „Un prince de la Renaissance. Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604)“ des MNHA Luxemburg im zugehörigen Ausstellungskatalog publiziert.