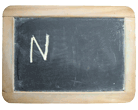Franziska Scheer MA
Biographisches
*1990. Ab 2010 Bachelorstudium der Kunstgeschichte und der Klassischen Archäologie an der Universität Trier. Abschluss 2013 mit der Bachelorarbeit zum Thema „Das Vorbild Antike – Antikenrezeption im Medici-Zyklus von Peter Paul Rubens“. Im März 2012 studienbegleitendes Praktikum in der Galerie Kaschenbach in Trier mit Schwerpunkt auf An- und Verkauf von Kunstobjekten sowie Katalogisierungsarbeiten. Ab 2013 Studium der Kunstgeschichte im Kernfachstudiengang; 2015 Abschluss mit dem Master of Arts zum Thema „Antoni Gaudís ‚katalanisches‘ Gesamtkunstwerk – Der Einfluss der nationalen Identität unter besonderer Berücksichtigung des Park Güell und seiner Herleitung“. Seit März 2016 Doktorandin bei Prof. Dr. Dr. Andreas Tacke.
Forschungsinteressen
- Niederländische Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts
- Antikenrezeption in der Frühen Neuzeit
- Historische Entwicklung des Kunsthandels
- Spanische Architektur im 19. und 20. Jahrhundert
Bachelorarbeit
Das Vorbild Antike – Die Antikenrezeption im Medici-Zyklus von Peter Paul Rubens
(November 2013)
Kenntnisse von der Antike galten seit der Mitte des 16. Jahrhunderts als Voraussetzung für die Künstler der Niederlande. Für Gelehrte und Künstler der Renaissance bedeutete die Antike – nicht zuletzt im Zusammenhang mit den Auffassungen des Humanismus – etwas Sakrales, dass es zu bewahren galt. Basierend auf dieser Wertschätzung beschäftigt sich die Arbeit mit den 24 Gemälden des sogenannten Medici-Zyklus, den Peter Paul Rubens 1622 bis 1624 für Maria de‘ Medici, die Mutter des französischen Königs Ludwigs XIII., in Anlehnung an die antike Mythologie angefertigt hatte. Den thematischen Schwerpunkt der Arbeit bildet die Analyse der Anlehnungen an die griechische bzw. römische Mythologie, wobei die mythologischen Figuren als Stellvertreter für die in Ungnade gefallene Königin und ihren Sohn fungieren. Obgleich diese Vorgehensweise, in der die Mythologie allegorisch für politische Ideen der Gegenwart genutzt wird, schon seit der Antike üblich ist, gehen Rubens Bildwerke noch darüber hinaus: Verglichen mit den üblichen Darstellungsweisen, strebte er eine Synthese der nationalen Geschichte und der Verherrlichung eines Monarchen auf allegorischer Ebene an.
Masterarbeit
Antoni Gaudís ‚katalanisches‘ Gesamtkunstwerk – Der Einfluss der nationalen Identität unter besonderer Berücksichtigung des Park Güell und seiner Herleitung
(Oktober 2015)
Das Zentrum der Arbeit bilden die Bauwerke des katalanischen Architekten Antoni Gaudí, der vor allem durch seine expressionistische Formensprache berühmt wurde. Seine Architekturauffassung war eng verbunden mit seinem eigenen Leben und den kulturellen sowie politischen Umständen seiner Zeit. Gaudí gilt als Hauptvertreter des Modernisme, der oftmals mit dem Jugendstil gleichgesetzt wird. Diese genuin katalanische Architekturrichtung entstand während der Renaixença, der katalanischen Renaissance, die sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts als eine kulturelle Revolution in der Literatur, Kunst und Architektur manifestierte und sich auf die Rückbesinnung traditioneller katalanischer Werte berief. Gefördert durch seinen Freund und Mäzen Eusebi Güell, wurde es Gaudi ermöglicht seine eigenen Interpretationen der Architektur und des Gesamtkunstwerkes immer neu zu entfalten – basierend auf den Theorien von Augustus Pugin, John Ruskin, William Morris und Viollet-le-Duc. Der Park Güell ist in diesem Zusammenhang besonders hervorzuheben, da er mit dem Vorbild der englischen Landschaftsgärten und Gartenstädte zu einem katalanischen Landschaftsgarten wurde und durch Verbindung mit der Gartenkunst über die Gestaltung der Stadthäuser hinausgehen und die Landschaft und Vegetation Kataloniens integrieren konnte. Gaudí schuf sich seine eigene nationale Architektur unter Einbindung aller, für ihn bedeutenden, künstlerischen und kulturellen Aspekte, die sich schließlich zu einem ‚katalanischen‘ Gesamtkunstwerk verbanden.
Dissertationsvorhaben (betreut von Prof. Dr. Dr. Tacke)
Kunstwerk und Kunstwert – Untersuchung der Preisentwicklungen niederländischer Kunst im Kunsthandel des ‚Goldenen Zeitalters‘
(Arbeitstitel)
Der Handel mit Kunstwerken wird in verschiedenen Ausprägungen schon seit der Antike betrieben. Während im Mittelalter die Künstler in Zünften oder Gilden für Auftraggeber arbeiteten, gingen sie am Ende der Epoche dazu über ihre Werke in verschiedenen Städten zu verkaufen. Doch von einem Kunsthandel im eigentlichen Sinne kann man erst nach der Renaissance sprechen. Der erste ‚echte‘ Kunstmarkt entstand im 17. Jahrhundert in den Niederlanden. Dort drängte der Markt das bis dahin vorherrschende Mäzenatentum zurück. Sicherlich gab es immer noch Künstler, die auf private Auftraggeber angewiesen waren, doch arbeiteten sie mehr und mehr auch für einen noch anonymen Markt, der sich aus Verkaufsausstellungen der Lukasgilden, den neu entstehenden Malerbrüderschaften, den Lotterien und natürlich den Kunsthändlern zusammensetzte. Kunstwerke wurden zu Waren, die eigens für den Handel geschaffen wurden. Zu Beginn der Arbeit wird zunächst ein Überblick geschaffen, der die Entwicklung des Kunstmarktes in den Niederlanden des 16. und 17. Jahrhunderts umreißt. Die Frage nach den jeweiligen Entstehungskontexten der Werte für Kunstwerke ist dabei von primärer Bedeutung: Welche Rolle spielen etwa die Gattung, die Technik, das Sujet sowie die Bekanntheit des Malers? Vor allem stellt sich die Frage, wer die jeweiligen Preise überhaupt bestimmt? Vorrangiges Ziel der Arbeit soll es zunächst sein, einen Überblick über die Preise des zeitgenössischen Kunstmarktes zu erhalten und diese in Kategorien – beispielsweise nach der Gattungshierarchie sortiert – einzuordnen, wobei ein Vergleich zwischen flämischen und holländischen Künstlern angestrebt wird. Um zu einer detaillierteren Aussage zu gelangen, werden anschließend die Preise der Kunstwerke ausgewählter Künstler untersucht, um herauszufinden, welche speziellen Faktoren im Umkreis des jeweiligen Künstlers die Preise ausschlaggebend bestimmen könnten; wie etwa die Wirtschaft, regionale Wertschätzung oder ästhetische Gründe. Bei Künstlern wie Peter Paul Rubens und Rembrandt ist wohl anzunehmen, dass sie aufgrund ihres schon damals immensen Bekanntheitsgrades höhere Preise erzielten als weniger bekannte Künstler aus Antwerpen oder Amsterdam. Doch ob dies tatsächlich der Fall ist oder nicht doch andere Faktoren einen höheren Einfluss ausüben, gilt es zu untersuchen.