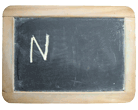Elke Valentin M.A.
Biographisches
Geb. 1969. Ausbildung als Bibliotheksassistentin an wiss. Bibliotheken. Studium der Anglistik und Galloromanistik in Stuttgart, der Kunstgeschichte und Romanischen Philologie in Tübingen. 2000 Auslandsaufenthalt in Siena (Università per Stranieri) und Florenz (Laboratorio Restauri, Palazzo Pitti). 2005 Magistra Artium. 2005-2007 wiss. Volontariat bei den Staatl. Schlössern und Gärten Baden-Württemberg in Bruchsal. Seit 2007 freiberufliche Kunsthistorikerin: u.a. Konzeption und Organisation der Ausstellung und der Katalogbroschüre "Rosenblatt & Federkiel. Wiblinger Bücherschätze aus fünf Jahrhunderten" für die Staatl. Schlösser und Gärten Baden-Württ. in Ulm (2008/09), Archivrecherchen zur Gartennutzung in Kloster Maulbronn in nachreformatorischer Zeit (2009/10). Zur Zeit u.a. Mitarbeit, Organisation und Marketing der Publikationen der Akademie Schloss Solitude Stuttgart: Edition Solitude.
Dissertationsvorhaben (betreut durch Prof. Dr Dr. Tacke)
Gemäldesammlungen in deutschen Rathäusern der Frühen Neuzeit bis zu ihrer Auflösung am Ende des Alten Reiches unter
besonderer Berücksichtigung Nürnbergs
(Arbeitstitel)
Bereits seit den 1520er Jahren hingen im Rathaus der freien Reichsstadt Nürnberg bedeutende Gemälde Albrecht Dürers und bildeten in der Regimentstube zusammen mit weiteren Nürnberger 'Kunststücken' und Erzeugnissen wie Goldschmiedearbeiten, dem Behaim-Globus, wissenschaftlichen Instrumenten oder auch dem Drachenleuchter von Veit Stoss einen repräsentativen Raum. Einzelne Portraits, später ganze Bildnisreihen von Kaisern und Königen zählten im Rathaus der Stadt Nürnberg, wie überhaupt in vielen Rathäusern, zum weiteren frühen Gemäldebestand. Die wohl umfangreichsten Zuwächse erfuhr die Rathaussammlung durch die pflichtweise Ablieferung des Meister- oder Probestücks, das Ende des 16. Jahrhunderts durch die Nürnberger Malerordnung geregelt und weit über einhundert Jahre durchgesetzt wurde. Darüber hinaus erhielt die Stadt in der reichsstädtischen Zeit durch Verehrungen sowohl von Einzelpersonen - hier ist beispielsweise an auswärtige, niederlassungswillige oder durchreisende Maler zu denken - als auch im Rahmen des diplomatischen Geschenkwesens stetig Gemälde, die im Rathaus, später auch auf der Nürnberger Burg, präsentiert wurden.
Erstaunlicherweise erfuhr der umfangreiche und qualitätvolle Nürnberger Gemäldebestand als Ganzes sowie städtische Sammlungen und ihr Aufstellungsort 'Rathaus' im Allgemeinen in der Forschung nur wenig Beachtung. So bedarf Wilhelm Schwemmers etwas missverständlich formulierte These, die Sammlung verdiene das Etikett einer genuin "nürnbergischen Galerie" erläutert und neu bewertet werden. Denn vor dem Hintergrund Nürnbergs als bedeutender Versammlungsort des Reiches ist zu klären, in welchem Maße sich Reichstage, Kaiserbesuche, der Friedensexekutionskongress 1649/50 aber auch konfessionelle Konflikte auf den Zuzug von Malern in die Stadt und damit unmittelbar auf die Gemäldesammlung, ihre Zusammensetzung und ihr 'Wesen' auswirkten und kunstgeographisch zu fassen sind.
Geht es im Ganzen also darum, die Entwicklung der Sammlung und ihren Bestand an geeigneten zeitlichen Punkten zu rekonstruieren, so gilt es weiter nach ihren Funktionen zu fragen. Sicherlich zählen hierzu 'Repräsentation' auf der städtischen Seite, als Beispiel sei hier das großformatige Friedensmahl von Joachim von Sandrart aus dem Jahr 1650 genannt, und/oder memoriale Intentionen von Seiten der Künstler, wie sie Albrecht Dürer mit der Verehrung der Vier Apostel (1526) zu seinem "gedechtnus" beispielgebend zuerst in Nürnberg vertrat. Es ist daneben zu vermuten, dass mit teilweise auffallend groß angebrachten Signaturen und Datierungen Maler die Aufmerksamkeit potentieller Käufer und Liebhaber auf ihre Werke lenken wollten, was wiederum Fragen der Zurschaustellung, Zugänglichkeit und 'Öffentlichkeit' der Rathausgalerie aufwirft. Inwieweit also der Gemäldesammlung, von der zahlreiche Objekte bis heute im Eigentum der Stadt Nürnberg verblieben sind, weniger museale Aspekte anhafteten, sie Malern als öffentliche Bühne und 'Studienort' diente und damit an vergleichbare italienische Verkaufsaufstellungen anschließt, soll untersucht werden.
Das Dissertationsprojekt ist als Fallstudie angelegt, soll den bisherigen Forschungsstand der Sammlungsgeschichte und ihren Präsentationsorten erweitern und wird einen neuen Beitrag zur Künstlersozialgeschichte leisten.
Magisterarbeit
Das Georgium in Dessau. Zur Ikonographie und Ästhetik
eines Landschaftsgartens des 18. Jahrhunderts
(2005, Eberhard-Karls-Universität Tübingen)
Publikationen
wissenschaftlich:
- Barockmalerei am Stuttgarter Hof. Das "Aufschreibbuch" und Selbstzeugnis des Hofmalers Friedrich Nikolaus List († 1685) (in Vorbereitung)
- Die Wiblinger Kupferstichsammlung - ein Beitrag zur Sammlungs- und Wissenschaftsgeschichte in Klöstern im 18. Jahrhundert (Aufsatz, in Vorbereitung)
- Ein Dilettant der Inkunabelkunde im 18. Jahrhundert? P. Amand Storr (OSB) (Aufsatz, noch nicht eingereicht)
- Katalogbeitrag "Parks und Gärten" und 13 Katalognummern, in: Anhalt in alten Ansichten. Landschaft, Baukunst, Lebenswelten/Hrsg. Norbert Michels. Halle 2006, S. 203-221.
- Druckgraphik nach Architektur und Plastik, in: „Erfreuen und Belehren“. 100 Jahre Graphische Sammlung am Kunsthistorischen Institut der Eberhard-Karls-Universität Tübingen/Hrsg. Anette Michels. Sigmaringen 1997, S. 59ff.
populärwissenschaftlich:
- Rosenblatt & Federkiel. Wiblinger Bücherschätze aus fünf Jahrhunderten. Katalogbroschüre zur Ausst. Kloster Wiblingen (Ulm), 29.4.-26.7.2009/Hrsg. Staatl. Schlösser und Gärten
Baden-Württemberg. Bruchsal 2009.
- Das Georgium - Schloss und Landschaftsgarten des Prinzen Johann Georg von Anhalt-Dessau, in: Dessau - Porträt einer Stadt. Dössel 2006.